Politikwissenschaftler sehen die Demokratie unter Druck
von Robert Grünewald*
Seit 2011 erscheint „INDES – Zeitschrift für Politik und Gesellschaft“, ein relativ neues Fachjournal also, das von dem Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker herausgegeben wird. Und obwohl er und der frühere Herausgeber Franz Walter nach ihrem Selbstverständnis der Sozialdemokratie als Parteimitglieder nicht nur nahestehen, wie es eine ehemalige Bundeskanzlerin für ihre Partei einmal formulierte, erhebt INDES den Anspruch, als unabhängig und keinem politischen Lager zugeordnet wahrgenommen zu werden und neue Wege zu gehen, indem das „Meinungsspektrum um neue Sichtweisen und unkonventionelle Alternativen erweitert“ werden soll.
Auch das neue Heft in der Doppelausgabe 1/2 mit dem Titel „Demokratie unter Druck“ ist wieder ein voluminös geratener Sammelband – die Bezeichnung Heft ist in Anbetracht eines Umfangs von 347 Seiten mit nicht weniger als 46 Beiträgen bekannter und weniger bekannter Autoren eher untertrieben. Es nimmt das 75-jährige Bestehen der bundesrepublikanischen Demokratie zum Anlass, selbige aus zahlreichen Blickwinkeln zu analysieren, zu kommentieren und soweit es um Personen geht, auch zu portraitieren. Das weite Feld, das hier in den Blickwinkel genommen wird, erstreckt sich über die Institutionen der Demokratie, Direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung, das Parteiensystem und schließlich den Rechtspopulismus, wobei die letzten beiden Forschungsfelder sicherlich nicht ohne weiteres voneinander zu trennen sind, da sich der Rechtspopulismus ja auch in der Herausbildung neuer Parteien manifestiert.
Unter den Beiträgen zu den Institutionen ragt an erster Stelle derjenige von Peter Graf Kielmansegg hervor, den man zu den herausragenden politischen Kommentatoren der bundesrepublikanischen Demokratiegeschichte zählen muss. In seinem Beitrag „Das Grundgesetz – eine Verfassung der Freiheit?“ überrascht zunächst das Fragezeichen in der Überschrift. Konstitutionelle Freiheitszweifel räumt er aber gleich zu Beginn wieder aus, um freilich zu erklären, dass die Tendenz, das Grundgesetz als eine Art politischen Bekenntnistext zu verstehen und als solchen den Bürgern anzusinnen, seine Offenheit gefährdet. Er macht dies am Beispiel des Verfassungsschutzes und seiner leitenden Personen fest, die letztendlich um eine Gesinnungsschnüffelei nicht herumkommen, wenn sie denn die AfD effektiv als verfassungsfeindliche Partei decouvrieren wollen. Er warnt zurecht davor, „das Verbot, die Verfassung in ihren Grundsätzen aktiv zu bekämpfen,“ umzudeuten „in ein Gebot, sich zu einer Gesinnungsgemeinschaft von Verfassungsfreunden zu bekennen.“ So gesehen, ist das Fragezeichen mehr als verständlich.
Fragezeichen zu ihrer eigenen Rolle indes kennen die Protagonisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht, wo sie sich doch gerne als institutionelle Säule der Demokratie gerieren. Gleichwohl hat dies nicht verhindert, dass der Rundfunk wegen einer Reihe von Missständen in die Kritik geraten ist und sowohl von Bürgerinnen und Bürgern wie von politischer Seite eine grundlegende Reform gefordert wird. Mit den Vorschlägen des Zukunftsrates befassen sich in einem Kommentar die Politikwissenschaftler Florian Grotz und Wolfgang Schroeder in „Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Resilienz der Demokratie“. Das Gremium setzt bekanntlich vor allem auf Verschlankung und Schwerpunktsetzung bei den Aufgaben an, was die Autoren als nachvollziehbar bezeichnen, und schlägt zudem Maßnahmen für eine bessere Transparenz und vor allem Kontrolle der Anstalten vor. Den Autoren geht dies allerdings nicht weit genug, da etwa die vorgeschlagene Zusammensetzung der Kontrollgremien nicht gewährleiste, dass sie sich an den Interessen der Allgemeinheit orientiert. Sie bezweifeln, dass so die teilweise verloren gegangene Akzeptanz und Legitimation des Rundfunks wieder hergestellt werden könne. Ein Versäumnis sehen sie auch darin, dass die Medienpolitik viel zu lange Medienwissenschaftlern und Juristen überlassen worden ist. Sie fordern für den Umbau des ÖRR eine stärkere Beteiligung der Politikwissenschaft mit ihrer genuinen Demokratie-Expertise, wenn es dabei bleiben soll, dass sich eine resiliente Demokratie auch in Institutionen wie dem ÖRR manifestiert.
Ob sich Demokratie auch in bürokratischen Strukturen manifestieren kann? Noch so ein Fragezeichen, das nunmehr der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann hinter die Alternative „Feinde oder Verbündete?“ setzt, wenn er nach dem Verhältnis von Bürokratie und Demokratie fragt. Er beruft sich zunächst auf keinen geringeren als Max Weber, der bekanntlich die Leistung der Bürokratie für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats als rationale Unverzichtbarkeit gesehen hat. Alemann konzediert die Schattenseiten der Bürokratie, warnt aber davor, mit wohlfeilen Bürokratieabbau-Forderungen das Kind mit dem Bade auszuschütten. Nicht selten stünden hinter solchen Forderungen nicht das Gemeinwohlinteresse, sondern privatwirtschaftliche Gewinnerzielungsabsichten. „Demokratie und Bürokratie sind keine Feinde, sondern Geschwister“, so Alemanns Fazit.
Das demokratische Institutionengefüge in den Blick nimmt der Parteienforscher Volker Best, dies vor allem vor dem Hintergrund der Umwälzungen in der Parteienlandschaft. Ihm sind Ausrufezeichen lieber als Fragezeichen: „Du musst Deine Demokratie ändern!“ überschreibt er etwas plastisch seine Forderung nach Anpassungen im demokratischen System in Anlehnung an den sizilianischen Schriftsteller Tomasi di Lampedusa, der in seinem Familienroman „Der Leopard“ den Untergang einer Adelsfamilie wegen ihrer passiven Lebenseinstellung und Nichtanpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen beschreibt. Den meisten dürfte vor allem die Verfilmung mit Burt Lancaster in der Hauptrolle bekannt sein. Best, dem es schon in seinen bisherigen Arbeiten vor allem um die Funktionsfähigkeit des demokratischen Systems in Anbetracht der parteipolitischen Umwälzungen geht, und der dabei auch vor unkonventionellen Vorschlägen nicht zurückschreckt, sieht nun mit der Erstarkung vor allem der AfD eine Situation gekommen, die die etablierten Parteien in nicht gewollte Koalitionen zwingt mit zwangsläufigen politischen Differenzen, deren Austragung zu einem Machtverfall der Bundesregierung und zur Delegitimierung des Wahlsystems geführt hat, während die Parteienzersplitterung eine Degeneration des Bundesverfassungsgerichts zu einem Repräsentativgremium zur Folge haben werde. Einziger Profiteur in dieser Gemengelage sei der Bundespräsident, der bei tendenzieller Nichtmehrheitsfähigkeit der politischen Lager in die Rolle des Kanzlermachers wachsen könnte. Wegen der skizzierten negativen Folgen für die Verfassungsorgane und um dem damit einher gehenden Funktionsverfall des politischen Systems entgegenzuwirken, wiederholt Best einen schon früher gemachten Vorschlag: „Kohärente Koalitionen könnten durch eine Mehrheitsprämie wiederhergestellt werden, die dem stärksten Vorwahlbündnis eine knappe Parlamentsmehrheit zuteilt.“ Gleichzeitig solle dem Bundesrat statt Einholung der Zustimmung nur noch ein Vetorecht eingeräumt werden. Damit die politische Klasse sich auf einen solch gravierenden Wandel im demokratischen System einlässt, dazu bedarf es freilich noch großer Überzeugungsarbeit und vielleicht – schlimmer noch – einer weiteren Verschärfung der Probleme.
Zur Beantwortung der Frage, ob und wie sich Demokratien schützen können, wenn sich die Probleme verschärfen und die Lage sich zuspitzt, dazu hilft manchmal auch ein Blick in die Geschichte. Der renommierte Göttinger Parteienforscher Franz Walter, der vor allem mit seiner Forschung zu Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie bekannt wurde, wendet sich in seinem Beitrag „Republikschutz und paramilitärische Zivilgesellschaft – das demokratische Dilemma in der Weimarer Republik“ der Frage zu, inwieweit der in der Weimarer Republik aufgetretene überparteiliche Deutsche Demokratische Reichsbund eine wirkliche demokratische Stütze für das im Volk verhasste Parteiensystem wurde. Um es vorwegzunehmen: Schon Mitte der 1920er Jahre geriet der Zusammenschluss in die Krise, weil man über schöngeistige Debatten, so Walter, bei gleichzeitigem Pazifismus und mangelnder Wehrhaftigkeit nicht hinauskam. Ein weiterer Zusammenschluss, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, übernahm zwar bald die Aufgabe, die demokratischen Parteien bei Auftritten wehrhaft zu schützen. Doch mit den Wahlniederlagen der Sozialdemokratie seit Beginn der 1930er Jahre schwand auch die Unterstützung für den demokratischen Wehrverband, der schließlich 1933 von den Nationalsozialisten verboten wurde. Franz Walter zieht daraus das fast schon resignative Fazit: „Wenn es in parlamentarisch verfassten Gesellschaften brodelt und wütet, nur wenige noch den Mahnungen zur Nüchternheit, Pragmatik, Besonnenheit folgen wollen, dann ist es nicht mehr so einfach mit dem Republikschutz.“
Der Niedergang der Weimarer Republik war auch eng mit dem Niedergang der Sozialdemokratie verbunden. Doch wiederholt sich das nicht gerade auch heutzutage? Der Trierer Parteienforscher Uwe Jun, der ebenfalls vor allem zur deutschen Sozialdemokratie forscht, geht in „Das Ende des Volksparteiensystems?“ der Frage nach, warum Union und SPD an Wählergunst verloren haben. Allerdings sind die Verluste bei der SPD wesentlich schmerzhafter ausgefallen als bei der Union, die sich im Moment wieder im Aufwind wähnt. Jun macht allerdings seine Feststellung nicht so sehr an der Wählerzustimmung als vielmehr an der Diagnose der schwindenden Milieus – christlich-konservativ hier, Arbeiterschicht dort – fest. Zudem seien ihre primär sozio-ökonomischen Themen überlagert und abgelöst worden von Themen der sozio-kulturellen Wettbewerbs- oder Wertedimension wie Klimaschutz und Migration. Vor allem letzteres Thema habe zahlreiche frühere Volksparteienwähler neuen Parteien zugetrieben wie AfD und BSW. Das Grundgerüst des Volksparteiensystems stehe zwar noch, es wanke aber bedenklich. Auf jeden Fall könne man sagen, dass die Zweiparteiendominanz von Union und SPD gebrochen sei und eine Pluralisierung im Parteiensystem vonstatten gehe, die aber nicht überzubewerten sei. Schließlich spiegelten sich darin gesellschaftliche Entwicklungen wider, die man nicht ignorieren könne.
Bei so viel wissenschaftlicher Hinwendung zur Sozialdemokratie ist man erleichtert, dass es in der Parteienforschung auch Wissenschaftler gibt, die sich der Union mit Verve zuwenden. Dies kann man von dem Hamburger Politikwissenschaftler und Soziologen Elmar Wiesendahl mit Fug und Recht behaupten. Er überrascht manchmal mit harschem Urteil, und auch in seinem Beitrag „Aufbruch im Rückwärtsgang – die CDU unter Merz“ spricht er gleich zu Beginn in markigen Worten davon, dass es in der deutschen Parteiengeschichte bisher keinen vergleichbaren Fall gegeben habe, wie den des Friedrich Merz, der sich als „politisch Abgedankter“ wieder an die Parteispitze hochgekämpft habe, um die CDU in eine neue Ära zu führen. Den mit dem Führungswechsel verbundenen Richtungswechsel charakterisiert Wiesendahl unverblümt als Kurs, dem ein „Gesellschaftsbild aus der Vor-Merkel-Zeit“ zugrunde liege. Er kehre den konservativen CDU-Markenkern hervor, zu dem Merkel sich nicht habe bekennen wollen, und verpasse der CDU ein „Mitte-rechts-Profil“, das Merz „auf den Leib geschrieben ist.“ Allerdings hänge ihm als „Wahlkampflokomotive ein Popularitätsdefizit an“, das er kaum abstreifen könne. Ein Lagerwahlkampf wie früher komme angesichts der veränderten Parteienlandschaft nicht mehr in Frage, weshalb Skepsis angebracht sei, „ob die Mitte-rechts-Verschiebung die CDU auf Erfolgskurs bringen wird“. Eher könnten die „Ampel-Misere“ und Zukunftsängste der Bevölkerung „die Zeichen auf Vorfahrt für die Union“ stellen.
Viel Unübersichtlichkeit also in der politischen Gemengelage vor der nächsten Bundestagswahl. Angesichts der Fülle der Darstellungen ist es unmöglich, an dieser Stelle auf alle Artikel einzugehen, die über die skizzierten Beiträge hinaus etwa die italienische Ministerpräsidentin Meloni porträtieren und ihre geplante Wahlrechtsreform analysieren, AfD und BSW genauer betrachten, den Populismus und populistische Einstellungen untersuchen oder Verschwörungstheorien als deren Beschleuniger konstatieren. Mit dem skizzierten wissenschaftlichen Panorama liefert INDES eine konzise und lesenswerte Beschreibung der Lage von Politik, Parteien und Gesellschaft vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr.
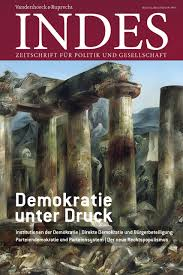
INDES – Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, Heft 1-2/2024, Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, 347 S., 42,- Euro.
*) Der Autor ist promovierter Politik- und Kommunikationswissenschaftler und nach langjähriger Tätigkeit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung jetzt Geschäftsführer der GPK Gesellschaft für Politische Kommunikation in Bonn.
