Der Politikwissenschaftler Veith Selk sieht die Demokratie im Rückwärtsgang
Buchbesprechung von Robert Grünewald*
Das vielleicht wichtigste Buch in jüngster Zeit zum Thema „Demokratie“ erschien schon im Oktober vergangenen Jahres. Der Darmstädter Politikwissenschaftler Veith Selk legte mit „Demokratiedämmerung“ einen Titel vor, der sich wohltuend von den heutzutage üblichen Publikationen abhebt, die sofort beim Rechtspopulismus der AfD sind, wenn sie Demokratieprobleme zu analysieren vorgeben. Als ob dies unser einziges Problem wäre. Dies war erst jüngst wieder zu erleben in der Sendereihe „Kulturfragen“ des DLF, die den Politologen Marcel Lewandowsky zu Gast hatte. Mit der Frage, ob es auch einen Linkspopulismus gebe, mochte er sich nicht beschäftigen, weil er sich dafür offensichtlich nicht interessiert. Dabei gibt es genügend Beispiele, angefangen bei den linken Populisten Lateinamerikas wie Chavez und Maduro über die Syriza in Griechenland mit dem Populisten Tsipras bis hin zur Linkspartei in Deutschland mit Politikern wie Lafontaine oder Gysi. Thematisch und inhaltlich ist der Linkspopulismus zuletzt vor allem mit seiner Globalisierungskritik und den Aktionen von Klimaaktivisten am deutlichsten in Erscheinung getreten.
Untersuchungen, die einen Rückgang der Demokratie hierzulande und weltweit diagnostizieren, gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Die Harvard-Professoren Levitsky und Ziblatt haben 2018 einen viel beachteten Band herausgegeben mit dem Titel „Wie Demokratien sterben“, der nicht nur das politische System der USA ins Auge fasst, sondern auch Deutschland und Europa. In Deutschland hat Andreas Reckwitz mit seinem „Ende der Illusionen“ (2019) den Ursachen für den Demokratieverfall nachgespürt, wobei er als Erklärung für den Aufstieg von Populisten eine Unterteilung in Links und Rechts für wenig hilfreich hält. Dass Entwicklungen in Amerika oft vorweggenommen werden und Deutschland und Europa mit zeitlicher Verzögerung folgen, ist eine allseits bekannte Tatsache. Allerdings haben amerikanische Autoren wie Thomas Carothers und Andrew Donohue 2019 in „The long path of polarization in the USA“ darauf hingewiesen, dass dem prekären Zustand der Demokratie in Amerika die gesellschaftliche Spaltung vorausging. Darauf hat auch der Autor dieser Zeilen in dem von ihm herausgegebenen Sammelband „Politische Parteien in der modernen Demokratie“ (2020) aufmerksam gemacht. Besteht diese „amerikanische“ Gefahr auch hierzulande?
Wenn es nach Veith Selk geht, ja. Allerdings gehen seiner Meinung nach die Gefahren vor allem von den handelnden Politikern aus. Seine Diagnose des Demokratieabbaus unter den Bedingungen der Modernisierung – er spricht von „Devolution“ – macht er an wenigen Phänomenen fest: Zunächst beklagt er eine „schleichende Entdemokratisierung des Wertesystems der Bürger“, wozu etwa das von einer politischen und elitären Minderheit der Mehrheit aufoktroyierte Gendern gehört, auch wenn er es nicht explizit nennt. Ferner nennt er den „Rückgang des Vertrauens in demokratische Institutionen und Regierungen“, die „Aufwertung expertokratischer Politikmodelle“ (man denke an das technische Kabinett Draghi in Italien) und – mit einem Blick in die Zukunft – die Entstehung „neuartiger, nachdemokratischer Regime“, die er als „demokratische Fürstenherrschaften“ bezeichnet. Diese legitimierten sich nur noch durch „mediale Spektakel“ und gerierten sich angesichts einer fortschreitenden Modernisierung und kaum noch steuerbaren Hyperkomplexität der Verhältnisse als starke und alternativlose Führungen.
Wie konnte es so weit kommen? Selk nennt eine Reihe von Ursachen, unter denen allerdings einige wenige besonders hervorstechen, weil sie auch politikwissenschaftlich untrainierten Lesern bekannt vorkommen. Da ist zum einen die „praktische Unwirksamkeit politischer Entscheidungen“, die nicht nur oppositionelle Politiker kritisieren, sondern von denen auch die eigene Anhängerschaft über kurz oder lang enttäuscht sein wird. Dies hängt damit zusammen, dass solche Entscheidungen häufig eben nicht zugunsten einer Problemlösung in der Sache getroffen werden, sondern um politisches Handeln, Aktivität, zu demonstrieren, um dem Vorwurf zu entgehen, man tue nichts. Während die politische Gegnerschaft dies meist durchschaut, geht die Enttäuschung über die Erfolglosigkeit vor allem mit den eigenen Anhängern nachhause, was sich über kurz oder lang im Schwund von Zustimmung und Gefolgschaft bemerkbar macht.
Der hier skizzierten Unwirksamkeit politischer Entscheidungen geht nach Selk häufig auch deren „epistemische Intransparenz“ voraus. Gemeint ist damit, dass unklar bleibt, wie politische Entscheidungen begründet werden. Vorgeschoben werden häufig wissenschaftliche Erkenntnisse im Modernisierungsprozess, ohne dass die Entscheidung für die Bürger durch den Zugang zu allen relevanten Informationen nachvollziehbar wäre. „Epistemische Transparenz verleiht dem politischen Handeln in der Demokratie Sinn und die demokratische Politik… kann verstanden und beurteilt werden“. Bei epistemischer Intransparenz wird es stattdessen für die Bürgerschaft zusehends schwierig, „allgemeine Sinnbezüge herzustellen und… ein Verständnis des politischen Prozesses im Ganzen zu gewinnen“, was eine wichtige Voraussetzung wäre für die Artikulation von Interessen im Prozess der Meinungs- und Willensbildung in der Demokratie.
Noch schwerwiegender sind die Folgen jedoch dort, wo Selk nur noch eine „simulative Demokratie“ am Werk sieht. Er versteht darunter eine Nachfolgeform der bisherigen liberal-repräsentativen Demokratie, die sich aufgrund des modernisierungsbedingten Wandels nicht mehr reproduziere, sondern sich in neuer Form präsentiere. Demokratie werde nur noch simuliert unter Einhaltung parlamentarischer und politischer Mehrheitsprinzipien insofern, als dem egoistischen Individualisierungsstreben innerhalb einer postmodernen Bürgerschaft nachgegeben wird, dies allerdings zu Lasten von Gemeinwohlorientierung und Selbstbegrenzung, ebenfalls bislang wichtige Prinzipien einer echten funktionierenden Demokratie. Demokratische Normen würden „nur noch als Vehikel zur Durchsetzung eigensinniger Interessen genutzt, ohne dabei Rücksicht auf deren Verallgemeinerbarkeit und Gemeinwohlbezug zu nehmen“. Die Politik habe die Praktiken der simulativen Demokratie adaptiert und befriedige die „radikalisierten Autonomiebedürfnisse postdemokratischer Bürger, ohne diese in die Pflicht zu nehmen“. Man muss nicht lange nachdenken, was mit einem Gemeinwesen passiert, das Demokratie nur noch als Instrument und Vehikel zur Durchsetzung partikularistischer Interessen begreift. Im Gesetzgebungsprozess des Gebäudeenergiegesetzes der Ampelregierung konnte man diesen Mechanismus fast in Reinkultur bestaunen.
Eine weitere Ursache für die Demokratie im Rückwärtsgang sieht Selk in der „institutionellen Heuchelei“. Heuchelei ist den Bürgern durchaus lebensweltlich vertraut und wird von ihnen mehr oder weniger als Element der Alltagsgestaltung auch bei Berufspolitikern akzeptiert. Institutionelle Heuchelei allerdings betrifft die zentralen politischen Institutionen der Demokratie, ist nicht mehr nur ein notwendiges Übel, sondern eine institutionelle Eigenschaft: „Die demokratischen Institutionen und der normale politische Betrieb werden dann als Fassaden interpretiert, hinter denen sich eine Plutokratie oder Oligarchie verbirgt.“ Mit anderen Worten: das Übertünchen von undemokratischem Sein durch demokratischen Anschein stellt auch die Demokratie als Ganzes in Frage.
Veith Selk hat mit „Demokratiedämmerung“ ein wichtiges Buch geschrieben. Die Diagnose des Demokratierückgangs kommt einleuchtend daher, wobei man eigentlich nur hoffen kann, dass sein schon zu Beginn getroffenes Diktum nicht eintrifft, dass den Ausgang der fortschreitenden Modernisierung „die Demokratien nicht überleben werden, sollte er sich fortsetzen.“ Gerne hätte man am Ende des Buches auch ein Literaturverzeichnis gesehen, so muss man sich die benutzte Literatur mühsam aus Text und Fußnoten zusammensuchen. Das umfangreiche Schlag- und Stichwortverzeichnis wäre dagegen nicht zwingend notwendig gewesen.
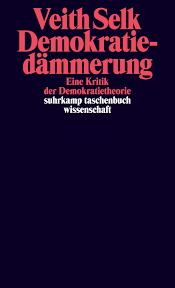
Veith Selk: Demokratiedämmerung. Eine Kritik der Demokratietheorie. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2023. 334 S., 23,- €.
*) Der Autor ist promovierter Politik- und Kommunikationswissenschaftler und Geschäftsführer der GPK Gesellschaft für Politische Kommunikation in Bonn.
